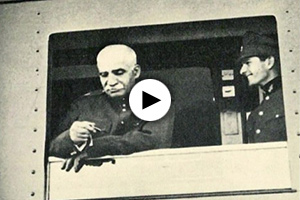In den Ruinen der Geschichte finden sich rätselhafte Punkte: die Wendepunkte. Lange Zeit koexistieren unvereinbare Realitäten nebeneinander. Ob die Geschichte den einen oder den anderen Verlauf nimmt, ist (zumindest für die Zeitgenossen) für eine gewisse Zeit unbestimmt. Plötzlich: die Wende. Von einer solchen Schlüsselentscheidung an nimmt die Geschichte einen linearen Verlauf. In seinem neusten Buch „Wendepunkte – Schlüsselentscheidungen im Zweiten Weltkrieg“ beschreibt der britische Historiker Ian Kershaw, berühmt durch seine zweibändige Hitler-Biografie, Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs. Besondere Schlüsselentscheidungen sieht er im Dezember 1941 (Russlandkrise, Pearl Harbour, Kriegserklärung Deutschlands gegen die USA), in der Haltung des britischen Kabinetts im Mai 1940 und in den Aktionen Japans unmittelbar vor der Schlacht von Midway. Hier liegen „Möglichkeit“ und Fiktion extrem dicht neben den Tatsachen.
► „Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs“ (News & Stories vom 15.02.2009)
Sehen Sie dazu auch auf dctp.tv
Die Planer des Dritten Reichs, die in den Jahren 1941 bis 1943 gigantische Aufgaben vor sich sahen aufgrund des Eroberungsfeldzugs Deutschlands gegen Russland, waren ganz junge Leute. Sie kamen aus den Debatten, die aufgrund der Wirtschaftskrise von 1929 entstanden waren, glaubten an eine neue Zeit und suchten ihre Lösungen aus dem Geiste einer „Zweckrationalität“ wie sie vom Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit in Industrie und Handwerk seit 1921 entwickelt wurde. Wenn man diese jungen Planer nur als nationalsozialistische Fundamentalisten und Rassenfanatiker deutet, verkennt man und verkleinert man das Problem. Die Methoden der Rationalisierung, die die Vernichtung von Menschen in Kauf nimmt, sind heute in der Welt und in Europa nicht gestorben und sie haben sich damals oft nur äußerlich in den Rahmen von Rassentheorie und nationalsozialistischen Vorgaben eingepasst. Im Konflikt zwischen Effizienz und Ideologie gaben sie oft der Effizienz den Vorzug. In diesem Kontext entstanden Planungshorizonte bis zur Krim, geplante Hungersnöte, Massenmord als Konsens, Projekte der „Umvolkung“, eine Großraumpolitik gegen Minderheiten, Mordprojekte, das Madagaskar-Projekt (Umsiedlung europäischer Juden auf diese Insel) und nicht zuletzt die Vernichtungslager. Erst die Not der Rückzüge im Jahre 1943 machte den Plänen ein Ende. Sie lassen sich an dem Musterprojekt Zamosc in Polen in den Einzelheiten studieren. Götz Aly hat in seinem Buch VORDENKER DER VERNICHTUNG. AUSCHWITZ UND DIE DEUTSCHEN PLÄNE FÜR EINE NEUE EUROPÄISCHE ORDNUNG den Zusammenhang dieser monströsen „Jugendkultur rationalistischen Geistes“ dargestellt.
Im Zweiten Weltkrieg begründeten die Alliierten in den Gebieten, die sie besetzt hielten, Besatzungszonen. Die erste Besetzung, der sogenannte „Testfall“, fand im Iran nach 1941 statt. Die Russen und die Briten errichteten in diesem Land Besatzungszonen. Nur mit Mühe konnten die Schäden, die diese Spaltung des Landes hervorrief, mit Hilfe der UNO und der U.S.A. repariert werden. Die Erfahrungen aus dem Iran wurden dann auf die Besatzungszonen in Deutschland 1945 übertragen. Aus den meisten im Iran aufgetauchten Problemen dagegen wurden keine Lehren gezogen. Sie wären bei der Besetzung Afghanistans oder dem Irak-Abenteuer Alarmsignale gewesen. Die Historikerin Jana Forsmann berichtet.
Von dem Ehrgeiz besessen, bei der Verteilung der Beute am Ende des Kriegs mit dabei zu sein, sandten Italien und sein Staatschef Mussolini eine ganze Armee in den Ostkrieg. Nach anfänglichen Erfolgen im Jahr 1941 stand diese Truppe unter dem (vor allem gastronomisch erfahrenen) Generaloberst Gariboldi und dessen aus der Gruppe der Elitekämpfer des 1. Weltkriegs stammenden Generalleutnant Messe in aussichtsloser Position am Don. Sobald die deutsche 6. Armee in Stalingrad eingeschlossen war, durchbrachen die Panzerverbände der Roten Armee die italienischen Linien. Es kam zu einem legendären Rückzug durch Eis und Schnee. Von 240.000 Mann, die auszogen, wurden am Ende noch 114.500 Überlebende gezählt. Dies war der erste Riss im deutsch-italienischen Bündnis. Zusammen mit der Landung der Alliierten auf Sizilien beendete dieses Ereignis die Herrschaft des Duce.
Privatdozent Dr. Thomas Schlemmer, Institut für Zeitgeschichte München, berichtet.